„Vertrauen hängt mit Kommunikation zusammen“
Interview mit Kommunikationsforscherin Maria Föttinger

Maria, was war das wichtigste Ergebnis deiner Arbeit? Was hat dich überrascht?
Ich habe die Studienteilnehmer:innen gefragt, wie sie die kommunikative Kompetenz von Forschenden wahrnehmen und wie vertrauenswürdig sie scheinen. Und tatsächlich ist ein positiver Zusammenhang zwischen der kommunikativen Kompetenz und der Vertrauenswürdigkeit berechenbar. Überrascht haben mich die Ergebnisse zu meiner zweiten Hypothese: Ich habe die Vertrauensbereitschaft der Studienteilnehmer:innen erfasst und mit der Vertrauenswürdigkeit von Cyber Valley korreliert. Diese Korrelation fiel entgegen meinen Erwartungen eher schwach aus. Denn man könnte ja denken, dass sich eine hohe Vertrauensbereitschaft der Proband:innen auch im Vertrauen in Cyber Valley widerspiegelt.
Vielmehr hängt die Vertrauenswürdigkeit mit der Einstellung der Studienteilnehmer:innen zum Forschungsgegenstand zusammen. Das haben die Berechnungen meiner vierten Hypothese ergeben: Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen der Grundeinstellung zum Forschungsfeld künstliche Intelligenz und der wahrgenommenen Vertrauenswürdigkeit von Cyber Valley. Die Ergebnisse sind zwar vorläufig, denn die Stichprobe war nicht repräsentativ. Sie bestand zum Großteil aus Studierenden. Aber relative Aussagen sind trotzdem möglich. Die Untersuchung müsste nun noch einmal repräsentativ für die Tübinger Stadtbevölkerung durchgeführt werden.
Warum ist Vertrauen überhaupt ein Thema für die rhetorische Kommunikationsforschung?
Wissenschaftler:innen und Menschen, die im Wissenschaftssystem arbeiten, denken häufig, dass die Bevölkerung ihnen vertraut, weil sie über Expertise verfügen. Wie wir auch in der Corona-Pandemie eindrücklich erleben konnten, reicht das allein aber nicht aus. Unklare Ziele, nicht kommunizierte Strategien oder nicht erfüllte Versprechen sind Beispiele kommunikativer Versäumnisse, die für Misstrauen sorgen können. Auch dann, wenn höchst kompetente Menschen überzeugende Argumente und wissenschaftliche Fakten liefern.
Welche Konsequenzen für Dialoge siehst du, wenn es dieses Vertrauen nicht gibt?
Überall wo Bürger:innen mitwirken und sich in den Dialog einbringen, ist es wichtig, dass dieser produktiv und konstruktiv geführt wird. Wenn kein Vertrauen da ist, muss erst mühevoll eine vernünftige Grundlage geschaffen werden, was schwierig und langwierig sein kann. Austausch, der auf Vertrauen basiert, begünstigt hingegen die Reputation und Effektivität von Forschungsinitiativen. Forscher:innen und Institutionen sollten besonders beim Thema KI neben der eigenen Expertise immer auch Nutzen und Risiken in Form von persönlichen, gesellschaftlichen, politischen und ökologischen Folgen mitkommunizieren. Kurz und vereinfacht gesagt: Vertrauen in die wissenschaftliche Institution Cyber Valley ist nicht nur das Ergebnis von Fachexpertise, sondern hängt auch wesentlich mit ihrer Kommunikation zusammen.
Welche weiteren Tipps für die Praxis leitest du aus deiner Untersuchung ab, um Vertrauen herzustellen?
Die Studie hat ja einen relativ hohen Zusammenhang ermittelt zwischen kommunikativer Kompetenz von Forschenden und darüber, wie vertrauenswürdig sie wirken. Deshalb liegt es nahe, über die kommunikativen Strategien nachzudenken, die Forscher:innen nutzen können.
Dialogräume zu schaffen etwa, das ist ein Schritt, den Cyber Valley durch die Public-Engagement-Angebote bereits getan hat. Hier sollten Gespräche über KI als Forschungsgegenstand mit Risiken und Chancen ermöglicht werden und unterschiedliche Stimmen zu Wort kommen. Eine weitere Strategie könnte sein, intern kommunikative Ziele für die einzelnen Forschungsprojekte festzuhalten. So wird auch die Selbstreflexion der Beteiligten und damit wertebasierte Forschung gestärkt. Durch die Ausformulierung der Ziele entsteht Textmaterial, welches als Fundus für die Kommunikation nach außen genutzt werden könnte. Wenn Forschende über die Selbstreflexion hinaus auch praktische Trainings für ihre eigene Wissenschaftskommunikation erhalten, wären einige wichtige kommunikative Aspekte abgedeckt, die zur Vertrauenswürdigkeit beitragen. Durch Dialogräume wird Wohlwollen signalisiert. Die Kommunikation von Zielen, die auf Grundlage von benennbaren Werten entstanden sind, zeigt Integrität an. Und Wissenschaftler:innen, die ihre Forschung verständlich und anschaulich erklären können, machen ihre Expertise besser zugänglich und damit wirksamer.
Nochmal zurück zur Methodik deiner Arbeit: Du hast zwei zeitlich sehr weit auseinanderliegende Theorien verbunden…
Ja, ich habe das Modell der Vertrauensentstehung, das der amerikanische Management- und Innovationsforscher Roger C. Mayer 1995 für die empirische Vertrauensforschung entwickelt hat, auch für die Entwicklung meiner Erhebung genutzt. Denn es gibt dazu einerseits gut validierte Messinstrumente. Andererseits weist es Ähnlichkeiten mit dem Ethos-Konstrukt beim antiken Philosophen Aristoteles auf. Und das wiederum ist ein zentraler Baustein der Rhetorik-Theorie. Das Modell von Mayer beschreibt die drei vorher genannten Dimensionen, die sich auf die Vertrauenswürdigkeit auswirken: Die Expertise, die Integrität und das Wohlwollen. Das aristotelische Ethos beschäftigt sich mit der Glaubwürdigkeit des Redners und umfasst die Dimensionen praktische Klugheit, sittliche Vortrefflichkeit und Wohlwollen. Hier spielen explizit kommunikative Aspekte eine stärkere Rolle. Deshalb habe ich dann zusätzlich noch die kommunikative Kompetenz ins Modell integriert. Erst dadurch konnte ich die gerade genannten Zusammenhänge identifizieren und Aussagen über die kommunikative Praxis machen.
Und damit hast du auch noch bevor es startete, einen interessanten Beitrag für das Tübinger Zentrum für rhetorische Wissenschaftskommunikationsforschung über künstliche Intelligenz (RHET AI) geleistet. Wir werden mit deinen Ergebnissen auf jeden Fall weiterarbeiten. Maria, vielen Dank für das Gespräch.
Zugehörige Artikel

Cyber Valley 1 feiert Eröffnung in Tübingen
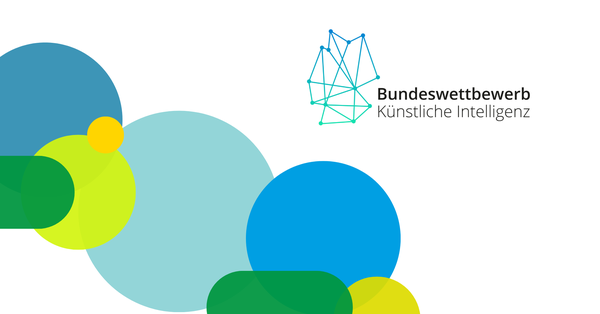
School pupils compete in the Federal Competition for Arti...

